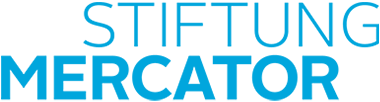Hintergrund
Die Welt steht am Anfang eines entscheidenden Jahrzehnts im Wettbewerb um die Ausgestaltung der zukünftigen internationalen Ordnung. Europa fällt dabei eine wichtige Rolle zu, in seinem eigenen und im internationalen Interesse. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine zeichnet sich durch eine dezidiert imperiale, antiliberale und antiwestliche Ideologie aus und markiert die Abkehr von den Grundpfeilern einer internationalen Ordnung, in der Interdependenzen als Friedensgarant galten. Die Spannungen zwischen China und den USA nehmen zu ebenso wie die Spaltung der Weltgemeinschaft. Dies passiert vor dem Hintergrund sich verschärfender und an Komplexität zunehmender, hybrider globaler Krisen, die sich an vielen Stellen gegenseitig bedingen und verstärken, wie der Corona-Pandemie, der Nahrungsmittel-, Energie- und Klimakrise.
Europa muss vor diesem Hintergrund seine Rolle in der Welt neu bestimmen, seine Außenbeziehungen strategisch gestalten und Stabilität im Innern herstellen, will es seine Werte und Interessen in der Welt behaupten und effektiv zur Bewältigung globaler Krisen beitragen.